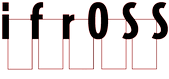Von Benjamin Roger
Das französische Gesetz zur "Verbreitung und zum Schutz des kreativen Schaffens im Internet" (auch Loi Hadopi), das die Sperrung des Internetanschlusses wegen Urheberrechtsverletzungen ermöglicht, ist nun verabschiedet worden. Auch in Deutschland hat es Begehrlichkeiten geweckt: der Vorsitzende des Bundesverbandes Musikindustrie, Dieter Gorny, hat sich ein entsprechendes Gesetz hierzulande gewünscht. Das französische Gesetz ist allerdings heftig umstritten, weil es eine sehr weitgehende Verantwortlichkeit für den eigenen Internetanschluss mit erheblichen Sanktionen bewehrt, die in einem rechtsstaatlich fragwürdigen Verfahren verhängt werden.
Hintergrund:
Die sog. Loi Hadopi (nach dem Namen der durch das Gesetz geschaffenen Behörde, der "Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet", hohe Behörde zur Verbreitung der Werke und zum Schutz der Rechte im Internet) ist am 13. Mai verabschiedet worden.
Herzstück des Gesetzes und Hauptkritikpunkt ist der sog. "gestufte Gegenschlag" bei (vermeintlichen) Urheberrechtsverstößen nach den neuen Artikeln L331-24 und L331-25 des Code de la propriété intellectuelle. Der neue Art. L336-3 dieses Gesetzbuchs sieht die Pflicht für Inhaber von Internetanschlüssen vor, dafür zu sorgen, dass dieser Anschluss nicht zu urheberrechtsverletzenden Handlungen genutzt wird. Werden der Hadopi Tatsachen bekannt, die einen Verstoß gegen diese Pflicht bilden können ("susceptible de constituer un manquement"), so kann die Behörde den Anschlussinhaber per E-Mail darauf hinweisen; im Falle eine Wiederholung innerhalb von sechs Monaten kann ein zweiter Hinweis per Einschreiben ergehen. Bei einem dritten Verstoß innerhalb eines weiteren Jahres kann die Behörde eine Sperrung des Internetanschlusses von zwei Monaten bis zu einem Jahr verfügen. Alternativ kann sie dem Anschlussinhaber aufgeben, Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Verletzungshandlungen zu ergreifen, insbesondere ein "Sicherungsmittel" zu installieren, womit ein - oft als "Spyware" kritisiertes - Programm zur Überwachung des Internetanschlusses gemeint ist (Art. L331-25). Die genauen Einzelheiten zu dessen Funktionieren werden nicht bekannt gegeben, jedenfalls wurden sämtliche Änderungsanträge, welche vorsahen, dass solche Programme kostenfrei und "interoperabel" (also mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel) sein müssen, abgelehnt.
Schon die Verteilung der Beweislast ist sehr fragwürdig: so muss der Anschlussinhaber seine Unschuld beweisen, denn Art. L331-25 setzt für repressive Maßnahmen lediglich die Möglichkeit einer Pflichtverletzung voraus. Freilich handelt es sich nicht um strafrechtliche Sanktionen (dass die Pflichtverletzung nach Art. L336-3 keine strafrechtliche Verantwortlichkeit nach sich zieht, stellt immerhin auch dessen Abs. 4 klar), so dass die Unschuldsvermutung nicht im strengen Sinne Anwendung findet; dennoch ist es hoch bedenklich, belastende Maßnahmen auf der Grundlage einer Vermutung zu ergreifen und dem Bürger dem Gegenbeweis aufzuerlegen - den er überdies nur schwer wird führen können, zumal Art. L331-24 Abs. 3 bestimmt, dass ihm der Zeitpunkt des Verstoßes, auf keinen Fall aber die betroffenen Werke mitgeteilt werden. Wirksam entlasten kann sich der Betroffene nur, indem er eine "Sicherungssoftware" (s.o.) einsetzt, oder wenn sein Anschluss "betrügerisch" (gemeint ist wohl: durch erschlichenen Zugang) genutzt wurde, oder in Fällen höherer Gewalt (Art. L336-3 Abs. 3). Gerade Nutzer von WLAN werden sich schwer tun, den Nachweis zu führen, dass in ihr Funknetz "eingebrochen" wurde; der Einsatz von Verschlüsselungsmechanismen, die dem Stand der Technik entsprechen, genügt gerade nicht, um sich von der Verantwortung zu befreien (letzterer Ansatz klingt etwa in der deutschen Rechtsprechung zur Störerhaftung an, vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 27.12.2007 - Az. I-20 W 157/07).
Eine gerichtliche Entscheidung wird nicht Voraussetzung für jene schweren Eingriffe sein, anders etwa als dies das EU-Parlament im Rahmen des "Telekom-Pakets" nachhaltig beschlossen hat. Auch der medienpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Thomas Jarzombek, hat erklärt, dass die Sperrung ohne richterlichen Beschluss grundgesetzwidrig wäre.
Hinzu kommt, dass Rechtsschutz nur gegen die Maßnahmen der "dritten Stufe", also Sperrung oder Auflage, eine "Sicherungssoftware" zu installieren, möglich ist (Art. L331-24 Abs. 4). Mit der Rechtsweggarantie nach deutschem Verständnis (s. Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz) wäre eine solche Regelung kaum zu vereinbaren, denn sie schließt Rechtsschutz gegen die "Mitteilungen" aus, obwohl diese für den Betroffenen durchaus eine belastende Wirkung haben (ihn nämlich zwingen, aufgrund nicht genau benannter angeblicher Verstöße sein Verhalten zu ändern, um das Risiko einer Sperre abzuwenden). Ferner wird der Rechtsschutz durch die unvollständige Information des Betroffenen (s.o.) behindert.
Angesichts der Bedeutung eines Internetzugangs heutzutage für die private und berufliche Entfaltung der Persönlichkeit, für Kommunikation und Teilhabe an der "Informationsgesellschaft", ist die Sperrung des Anschlusses eine - womöglich effiziente aber - sehr belastende Maßnahme. Es stellt sich sogar die Frage, ob sie nicht den Charakter einer strafrechtlichen Sanktion trägt und damit einen Schuldnachweis erfordern würde. Jedenfalls ist ihre Verhältnismäßigkeit im Fall der Loi Hadopi mehr als fraglich: die Sperrung des Internetzugangs setzt nämlich nicht mehr als die Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht voraus (s. Art. L336-3), welche gerade mit Blick auf Funknetze äußerst streng ist, s.o. Einen Vergleichsmaßstab mag die Verhängung eines Fahrverbots bilden, die selbstverständlich nur an eigenes Fehlverhalten im Verkehr anknüpft, nicht etwa an die unzulängliche Sicherung des Autoschlüssels.